Moodlekurs zum Didaktikum LA BA (Gr. 3, Do., 10:00-12:00) im Sommersemester 2021 bei Fr. Husemann.

- Lehrende(r): Charlotte Husemann
Moodlekurs zum Didaktikum LA BA (Gr. 3, Do., 10:00-12:00) im Sommersemester 2021 bei Fr. Husemann.

Moodlekurs zum Didaktikum LA BA (Gr. 2, Mi., 12:00-14:00) im Wintersemester 2020/21 bei Fr. Husemann.

Die Geschwisterbeziehung ist eine der längsten aber auch ambivalentesten sozialen Beziehungen im Leben. So zeichnen sich Geschwisterbeziehungen typischer Weise durch das gleichzeitige Vorhandensein von Liebe, Hass, Orientierung und Abgrenzung aus. Über die besonderen Merkmale und Mechanismen von Geschwisterbeziehungen können sich Geschwister auf vielfältige Weise gegenseitig beeinflussen, sei es in schulischen und beruflichen Entwicklung, bei der Partnerwahl oder in Einstellungen sowie der eigenen Gesundheit.
Trotz der Bedeutung von Geschwistern und dass 75% der Kinder unter 18 mit einem weiteren Geschwisterkind im Haushalt leben, bekommt die Eltern-Kind-Beziehung klassischer Weise mehr Aufmerksamkeit in der Wissenschaft. Im Seminar wollen wir uns daher dieser besonderen und spannenden Lebensbeziehung aus der aktuellen wissenschaftlichen Perspektive heraus widmen und lernen was Geschwisterbeziehungen ausmachen und wie sie uns über den Lebenslauf beeinflussen.
Zusätzliche Hinweise:
Das Seminar findet asynchron über Moodle und synchron über Zoom statt. Die synchrone Videositzungen werden alle 2 Wochen donnerstags in der Zeit von 16:15 bis 17:45 Uhr stattfinden.
Als Prüfungsleistung ist eine Hausarbeit (12-15 Seiten) vorgesehen. Die Studienleistungen umfassen eine Gruppenpräsentation zu einem englisch- oder deutschsprachigen wissenschaftlichen Text sowie in den Wochen ohne synchronem Treffen einzureichende Aufgaben im Selbststudium (z.B. Erstellung eines Mindmaps oder von eigenen Fragen zum Text oder eines Exzerpts).
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) mit Hauptsitz in Genf ist die älteste Teilorganisation der Vereinten Nationen (UN). Die ILO ist seit 1919 dafür zuständig, internationale Arbeits- und Sozialstandards zu entwickeln und durchzusetzen. Laut Mandat setzt sie sich für menschenwürdige Arbeit, soziale Sicherung und die Stärkung des sozialen Dialogs ein. Die ILO wurde 1919 nach dem Ersten Weltkrieg gegründet als Teil des Versailler Friedensvertrags. In ihrer Präambel verknüpft sie Frieden mit sozialer Gerechtigkeit: „ […] dass der Weltfriede auf Dauer nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden kann“ (Präambel der ILO, 1919). Durch internationale Standards sollte die zunehmende Verarmung großer Teile der Gesellschaft gestoppt werden.
Diese Veranstaltung führt in die Geschichte und Historiographie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ein: In welchem Kontext und zu welchem Zweck wurde die ILO gegründet? Wer ist in der ILO vertreten? Wie entwickelte sich die ILO im Laufe der Zeit? Inwiefern ist es der ILO gelungen, ihr Mandat erfolgreich umzusetzen? Ist die ILO insgesamt gut historisch erforscht, welche zentralen Forschungsdebatten gab es und wo sind noch Forschungslücken (Historiographie)?
In dieser Übung werden wir uns zunächst mit dem Entstehungskontext der ILO beschäftigen. Neben dem (sozialen) Frieden sollte mit Hilfe der ILO das Voranschreiten des Kommunismus gebremst werden angesichts der Oktoberrevolution von 1917 und der anschließenden Machtübernahme der Bolschewiki in Russland. Weitere Schwerpunkte liegen auf dem Aufbau und der Entwicklung der ILO im Laufe der Zeit. Insbesondere wollen wir die Rolle der ILO im Kampf gegen Kinderarbeit beleuchten. Die Arbeit führt in den aktuellen Forschungsstand ein und gibt zahlreiche Hinweise für potentielle Haus- und Qualifikationsarbeiten. Wir werden uns hands-on mit den digitalen Archiven der ILO auseinandersetzen.
Teilnahmevoraussetzung sind neben der aktiven Teilnahme die Lektüre englischer Texte und die Übernahme eines Referates. Die Themenwahl erfolgt zeitnah der Veranstaltung über LSF/Moodle.
Moodleraum zur Übung "Die römische Stadt" von Felix Schulte im SommerSemester 23
Dies ist der Moodleraum für die kunstpraktische Übung "Die unsichtbaren Städte" im Wintersemester 2020/21.
Dozent: Johannes Buchholz
Das aktuelle Seminar Dienstleistungtsheorie im Modul 15 findet im WiSe 2022/23 als
Präsenzveranstaltung statt und zwar im Blended Learning-Formate (als Kombination von Online- und Präsenzformaten).
Beginn ist ab Donnerstag, den 13. Oktober 2022.
Teil I (online/synchron) ist jeweils immer donnerstags von 14.15 bis 15.45 Uhr vom 13. Oktober 20022 bis zum 12. Januar 2023 als wöchentliche Videokonferenz (Online-Teil der Veranstaltung).
Teil II der Präsenzteil folgt dann als Block am Freitag, den 03. Februar 2023 von 09.00 bis 18.00 Uhr
Im Moodle-Kursraum sind bereits seit dem 2. September 2022 weitere Informationen und Materialien zum Kurs bereit gestellt. Das Passwort zum Moodle-Kurs erhalten Sie umgehend von mir, wenn Sie mir eine E-Mailanfrage schicken.
Weitere Informationen zum Kurs finden Sie auch auf der Webseite des Dozenten unter:
https://www.uni-due.de/members/richartz/index.php
unter der Rubrik "Aktuelles" alles zu den aktuellen Kursen und unter "Lehrveranstaltungen" generelle Informationen zur System- und Dienstleistungstheorie.
Das aktuelle Seminar Systemtheorie im Modul 15 findet im WiSe 2022/23 als Präsenzveranstaltung statt und zwar im Blended Learning-Formate (als Kombination von Online-und Präsenzformaten).
Beginn ist ab Donnerstag, den 06. April 2023.
Teil I (online/synchron) ist jeweils immer donnerstags von 14.15 bis 15.45 Uhr vom 06. April 2023 bis zum 15. Juni 2023 als wöchentliche Videokonferenz (Online-Teil der Veranstaltung).
Teil II der Präsenzteil folgt dann als Block in der Universität am Freitag, den 14. Juli 3023 von 09.00 bis 18.00 Uhr
Im Moodle-Kursraum sind bereits seit dem 30. Januar 2023 weitere Informationen und und Materialien zum Kurs bereit gestellt. Das Passwort zum Moodle-Kurs erhalten Sie umgehend von mir, wenn Sie mir eine E-Mailanfrage schicken.
Weitere Informationen finde Sie auch auf der Webseite des Dozenten an der UDE unter: https://www.uni-due.de/members/richartz/index.php und dort unter den Rubriken "Aktuelles" und "Lehrveranstaltungen".
Das aktuelle Seminar Dienstleistungstheorie im Modul 15 findet auch im SoSe 2021 als Onlinekurs statt.
Beginn ist ab Donnerstag, der 15. April 2021 jeweils immer donnerstags von 14.15 bis 15.45 Uhr. Im Moodle-Kursraum werden weitere Informationen und Materialien bereit gestellt. Das Passwort erhalten Sie umgehend von mir, wenn Sie mir eine E-Mailanfrage schicken.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Projektwebseite des Dozenten an der UDE unter:
https://www.uni-due.de/members/richartz/index.php
Das aktuelle Seminar Systemtheorie im Modul 15 findet auch im WiSe 2021/22 wieder als Onlinekurs statt.
Beginn ist ab Donnerstag, den 14. Oktober 2021 jeweils immer donnerstags von 14.15 bis 15.45 Uhr.
Im Moodle-Kursraum sind bereits seit dem 31. August 2021 weitere Informationen und Materialien zum Kurs bereit gestellt. Das Passwort zum Moodle-Kurs erhalten Sie umgehend von mir, wenn Sie mir eine E-Mailanfrage schicken.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Projektwebseite des Dozenten an der UDE unter:
https://www.uni-due.de/members/richartz/index.php
Das aktuelle Seminar Dienstleistungstheorie im Modul 15 findet auch im WiSe 2020 voraussichtlich wieder als Onlinekurs statt.
Beginn ist voraussichtlich ab Donnerstag, der 02. November jeweils immer donnerstags von 15.15 bis 16.45 Uhr. Im Moodle-Kursraum werden weitere Informationen und Materialien bereit gestellt.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Projektwebseite des Dozenten an der UDE unter:
https://www.uni-due.de/members/richartz/index.php
Dear students,
welcome to the Research Seminar/Project Winter 2021/2022 UDE/UPB.
Live-meetings:
This Moodle course is designed to help you navigate through the field of Australian studies. You will find a variety of historical, political and cultural topics presented with texts, videos and links. If you want to test or further your knowledge on the topics, you can do the quizzes or make use of further research collected in the folder at the end of each unit. The provided material might be useful as a basis for your own research projects, to prepare a teaching unit or simply to broaden your knowledge about Australia (e.g., as a preparation for a semester abroad). This project was funded by the Förderprogramm Lehr-Lern-Innovationen an der UDE.
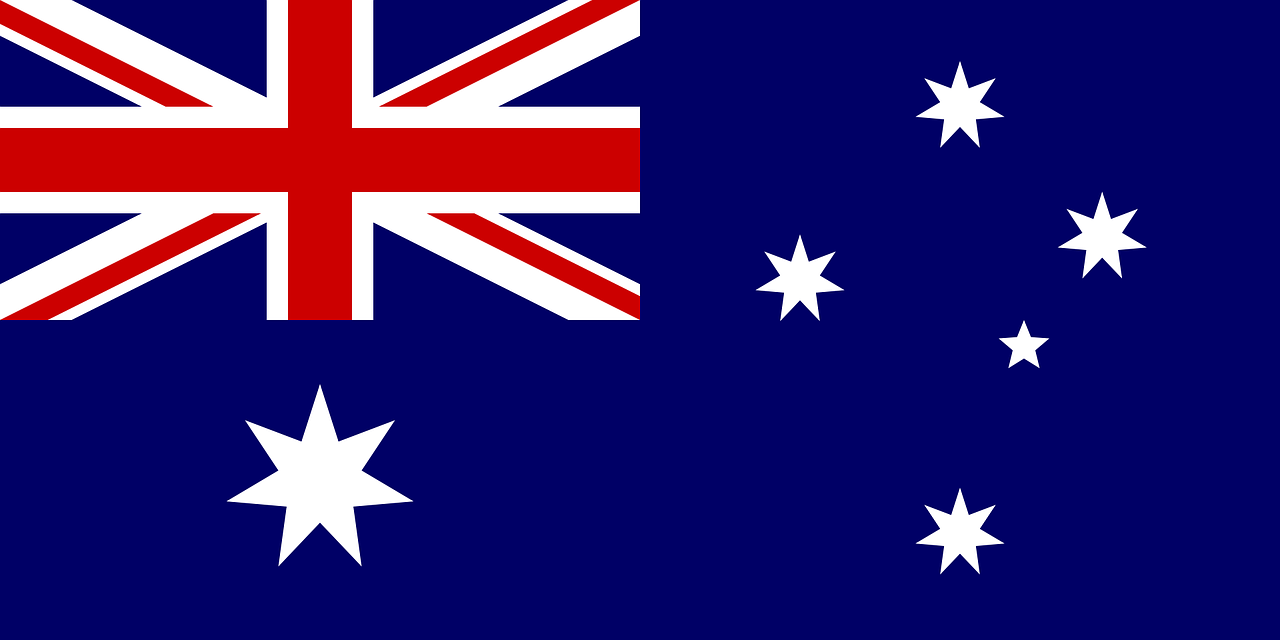
Veranstaltungsinhalt
Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden einen ersten Überblick über die Veränderungen bei traditionellen Geschäftsprozessen durch digitale Technologien zu geben. Die Teilnehmer/innen werden eingeführt in ein grundsätzliches Verständnis von digitalen Geschäftsprozessen (Digital Business) und lernen die Möglichkeiten innovativer Kommunikationsverfahren kennen. Dies umschließt insbesondere die Themen:Dieser Moodle-Kurs dient daher als digitale Lernplattform, über welche sämtliche Inhalte sowie die Kommunikation gesteuert werden.
Veranstaltungsinhalt
Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden einen ersten Überblick über die Veränderungen bei traditionellen Geschäftsprozessen durch digitale Technologien zu geben. Die Teilnehmer/innen werden eingeführt in ein grundsätzliches Verständnis von digitalen Geschäftsprozessen (Digital Business) und lernen die Möglichkeiten innovativer Kommunikationsverfahren kennen. Dies umschließt insbesondere die Themen:Auf Grund der aktuellen Corona-Situation, wird die Veranstaltung Digital Business im Sommersemester 2022 nicht als Vorlesung angeboten, sondern vollständig auf Distanzlehre umgestellt. Dieser Moodle-Kurs dient daher als digitale Lernplattform, über welche sämtliche Inhalte sowie die Kommunikation gesteuert werden.
Veranstaltungsinhalt
Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden einen ersten Überblick über die Veränderungen bei traditionellen Geschäftsprozessen durch digitale Technologien zu geben. Die Teilnehmer/innen werden eingeführt in ein grundsätzliches Verständnis von digitalen Geschäftsprozessen (Digital Business) und lernen die Möglichkeiten innovativer Kommunikationsverfahren kennen. Dies umschließt insbesondere die Themen:Auf Grund der aktuellen Corona-Situation, wird die Veranstaltung Digital Business im Sommersemester 2023 nicht als Vorlesung angeboten, sondern vollständig auf Distanzlehre umgestellt. Dieser Moodle-Kurs dient daher als digitale Lernplattform, über welche sämtliche Inhalte sowie die Kommunikation gesteuert werden.
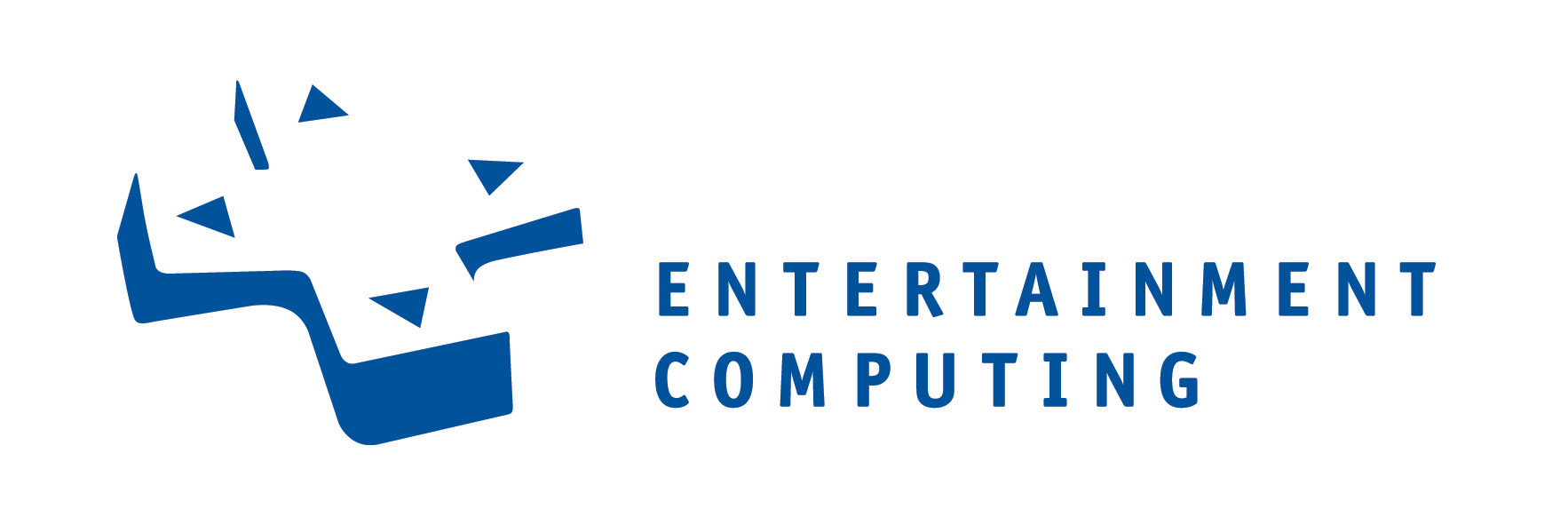
In diesem Moodle-Kurs finden Sie alle Unterlagen und Informationen zur Vorlesung Digitale Medien 2022.
In diesem Moodle-Kurs können Sie einen Termin für die digitale Sprechstunde von Frau Prof. Dr. Martina Richter buchen.